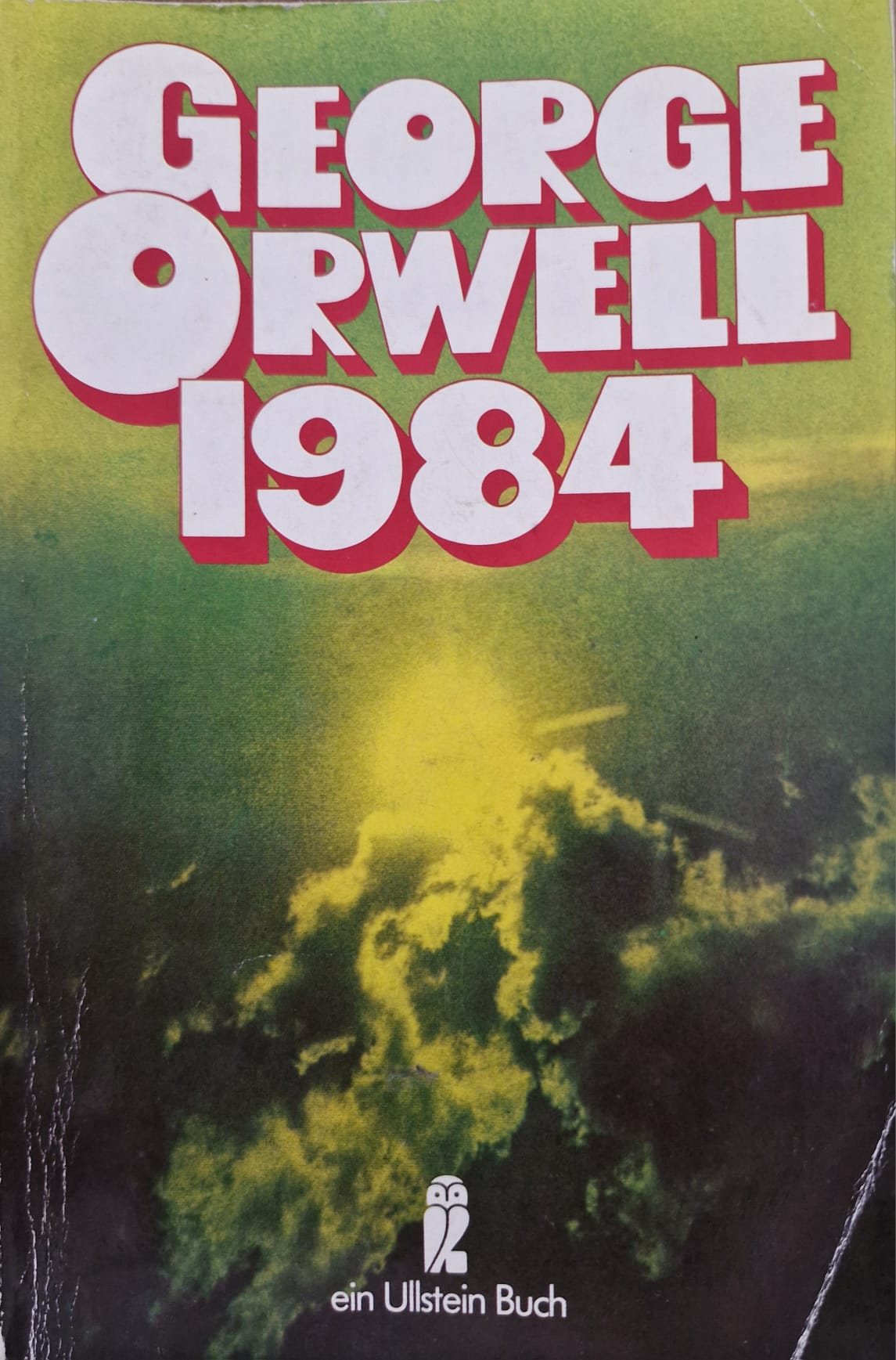1984
Gerade
war der Zweite Weltkrieg zu Ende. In dieser schwierigen Zeit hat
Georg Orwell wohl den Zukunftsroman des Russen Jewgeni Samjatin
(1884-1937) "Wir" gelesen. Die "Schöne Neue Welt"
von seinem Landsmann Aldous Huxley, erschienen 1932, hat ihn wohl
auch angeregt, sich und sein Leben zu hinterfragen. Er durfte noch im
Spanischen Bürgerkrieg kämpfen, aber als Freiwilliger im Krieg
gegen Deutschland wollte man ihn nicht an der Front und hat ihn für
untauglich erklärt.
Ich
denke, er hatte genug Zeit, die beiden erwähnten Romane zu lesen und
zu studieren. Ab 1946 setzte er sich an seine Schreibmaschine
verarbeitete die vergangenen Kriegsjahre und liess seiner Fantasie
über die nahe Zukunft im 1984 freien Lauf.
Wie
ich in meinen Anmerkungen im Ullstein Taschenbuch Nr. 3253
(erschienen 1976) notierte, habe ich den Roman, der mir heute noch
vorliegt, im August 1979 – damals war ich 18 – das erste Mal
gelesen. Ich war damals im zweiten Lehrjahr bei einer ziemlich
wichtigen Schweizer Versicherungsanstalt in Luzern.
Ich versuch mal, bei der vorliegenden Buchbesprechung, Kapitel für Kapitel die Stellen rauszupicken, die mir wichtig sind.
Der
erste Teil, Kapitel 1, fängt so an:
Es
war ein klarer, kalter Tag im April, und die Uhren schlugen gerade
dreizehn, als Winston Smith..... durch die Glastüren eines der
Häuser des Victory Blocks schlüpfte,... An der Rückwand war ein
grellfarbiges Plakat.... mit Reissnägeln an der Wand befestigt. ...
Winston ging die Treppe hinauf. Es hatte keinen Zweck, es mit dem
Aufzug zu versuchen... tagsüber war der elektrische Strom
abgestellt. ...
...der neununddreissig Jährige Winston, der über
dem rechten Fussknöchel dicke Krampfaderknoten hatte, ging sehr
langsam und ruhte sich mehrmals unterwegs aus. Der Grosse Bruder
sieht dich an!
Orwell hat für den Anfang der Geschichte gleich zwei starke Gegebenheiten gewählt: den in London kalten, unfreundlichen Monat April und die Uhrzeit 13 Uhr. Die Hauptfigur heisst zum Vornamen wie der berühmte Churchill, nur mit einem anderen Familiennamen. Smith ist ein allerweltsnamen. Die Plakate vom Grossen Bruder mit seiner drohenden Aussage "Ich sehe dich an!" hängen überall, wenn auch primitiv mit Reissnägeln an die Wand im Flur gepeppt.
Die einfache Wohnung wird von einem sogenannten Televisor oder Hörsehschirm eingenommen. Im Spiegel sieht er sich selbst als abgezehrte, gebrechliche Gestalt im Trainingsanzug der Parteiuniform. Im Fernsehen hört man ständig irgendwelche Leute reden. Er kann nicht ausgestellt werden, aber das Volumen kann geändert werden. Wie selbsterklärend, kann dieses Gerät nicht nur senden, sondern auch empfangen. Big brother watching you!
Winston hat das Glück, dass der Hörsehschirm in seinem Wohnzimmer an der falschen Wand hängt. Damit kann er einen toten Winkel ausnutzen und sich ungestört verbotenen Dingen widmen, wie zum Beispiel ein Tagebuch schreiben. Der Grosse Bruder will aber nicht nur immer alles hören und sehen, sondern schüchtert sein Volk auch mit einer Gedankenpolizei ein. Die drei Parteiwahlsprüche sind:
Krieg
bedeutet Frieden
Freiheit ist Sklaverei
Unwissenheit ist Stärke
Drei Wahlsprüche, die uns seit Menschengedenken begleiten – und zwar, egal, wer gerade regiert.
Im
zweiten Kapitel geht's um das Wohnhaus, das wie ein
Nachkriegswohnblock beschrieben wird. Jeden Tag werden um die 30
Bomben auf London abgeworfen. Eine Nachbarin braucht Smiths Hilfe,
weil das Waschbecken verstopft ist und ihr Mann gerade arbeitet. Wer
sich nicht selbst darum kümmern kann, ist verloren. Es scheint fast
keine oder nur sehr wenige Handwerker zu geben. Dafür überrascht
mich, dass seine Nachbarn eine Familie mit zwei Kindern sind. In den
Zukunftsromanen der Vorschreiber gibt es zwar Kinder, aber diese
wachsen ohne Eltern auf. Bei Orwell spielen die Kinder eine wichtige
Rolle für die Gedankenpolizei. Die eigenen Kinder überwachen die
eigenen Eltern und zeigen diese bei kleinsten Verfehlungen ohne
Gewissensbisse an. Als er wieder zuhause ist, verkündet der
Fernseher einen wichtigen Sieg über asiatische Feinde und gibt
nebenbei noch eine weitere Rationalisierung bekannt. Smith schreibt
weiter in sein Tagebuch und stellt sich die berechtigte Frage, die
sich alle stellen, die schreiben. Für wen schreibe ich eigentlich?
Weil
er weiss, dass er mit dem Schreiben gegen das Gesetz verstösst,
schreibt er, bevor er wieder zur Arbeit muss, folgenden Satz in sein
Tagebuch: Das Gedankenverbrechen zieht nicht den Tod nach sich;
das Gedankenverbrechen ist der Tod.
Im dritten Kapitel geht's um Morgengymnastik. Viele Mitteleuropäer denken, dass sie das Phänomen kennen, vor allem aus Russland und Asien. Während er Gymnastik macht, grinst er und denkt nach. Er grübelt über seinen Traum mit seiner Mutter und Schwester. Er fragt sich vor allem, was ist Vergangenheit und wie weit er sich an die Vergangenheit erinnern kann. Denn heutzutage gilt, was die Regierung unter dem Grossen Bruder bestimmt. Es wird versucht, die einzelnen Erinnerungen an die eigene Vergangenheit zu tilgen. Wenn man keinen Haltepunkt hat, kann man sich auch nicht an eigene Einzelheiten erinnern. Sie sterben ab. Aber seine eigenen Erinnerungen konnte er noch nicht richtig kontrollieren. Aber er zweifelte auch daran, ob das, woran er glaubte, wirklich wahr war. Der Grosse Bruder hat die Gegenwart fest im Griff, und das gilt somit auch für die Vergangenheit und die Zukunft.
Winston versucht sich zu erinnern, wann zum ersten Mal vom Grossen Bruder die Rede war. Er dachte, es war in den 1960ern, aber er konnte sich nicht sicher sein. In der gültigen Geschichte ist der Grosse Bruder von Anfang an dabei – seit Beginn der Revolution. Er denkt, dass seine Heldentaten zeitlich zurückversetzt und der Geschichte angepasst wurden. Keiner weiss so genau, was an der Legende wahr ist und was nicht. Es kann schon mal passieren, dass jemandem eine deutliche Lüge auffällt. Smith ist sich zum Beispiel sicher, dass es Flugzeuge schon vor der Partei gab. An Flieger mag er sich seit er ein Kind ist erinnern.
Im vierten kapitel lässt uns Winston Smith über die Schultern gucken und wir sehen, was seine Arbeit im Miniwahr ist. Seine Aufgabe besteht darin, richtig zu stellen, was für notwendig befunden wird. Einen Tag um den anderen und fast Minute zu Minute bringt er die Vergangenheit mit der Gegenwart in Einklang. Fälschungen von Fotofragien. Alles löst sich in einer Welt des leeren Schein auf, in der zuletzt sogar die gültige Jahreszeit unsicher geworden ist.
Der Roman 1984 wurde in London geschrieben, und zwar in den Nachkriegsjahren 1946 bis 1948. Der Autor war damals so um die 45 und hatte ein echt ereignisreiches Leben zwischen Asien und Europa hinter sich. Was er hier im vierten Kapitel beschreibt, ist keine Zukunftsutopie, sondern die Gegenwart, die schon ziemlich weit in die Vergangenheit reicht. Und selbst 2025 ist die Zukunft weiter ausgeklügelt, als im Buch beschrieben. Heute verschwinden Artikel aus den Sozialmedien, ohne dass jemand danach fragt. Die Leute, die sie sehen, vergessen nach ein paar Sekunden, was sie gelesen haben. Es fängt schon damit an, dass man etwas, das man vor ein paar Minuten oder sogar Sekunden noch gelesen hat, nochmal lesen will. Das heutige System ist so, dass es nicht mehr möglich ist, es zu nutzen, es sei denn, du hast dir den Namen des Autors gemerkt. Hier geht's nicht mal um Zensur, sondern darum, das Denken zu betäuben. Der Betrachter kann nicht einmal in Betracht ziehen, etwas nochmals anzusehen und vielleicht zu hinterfragen.
Zensur heute ist, wenn die moderne künstliche Intelligenz auf ein Wort stösst, das nicht akzeptabel ist, und der gesamte gepostete Inhalt sofort gelöscht wird. Es ist echt schlimm, dass man es nicht finden kann. Und es ist noch schlimmer, dass es eigentlich auch niemanden interessiert, ausser vielleicht der Person, die es gepostet hat.
Für
mich ist es besonders schlimm, da ich mit der Tagespresse
aufgewachsen bin. Jeden Tag sind wir zum Kiosk gegangen und haben die
aktuelle Ausgabe gekauft. Am Wochenende las ich immer in den
Sonntagszeitungen, um verschiedene Meinungen zu bestimmten
Geschehnissen zu lesen und mir so eine eigene Meinung zu bilden.
Heute geht das nicht mehr. Ich kann mir zwar auf dem Smartphone zum
Frühstück Zeitungen aus der ganzen Welt holen, aber die Bilder sind
überall gleich und auch der Text ist der gleiche, nur in einer
anderen Sprache. Es gibt keine Meinungen zu dem, was passiert ist. Es
gibt keine Hintergrundinformationen zu dem, was geschehen ist. Was
vor einer Woche noch von der ganzen Welt verurteilt wurde, ist heute
kein Thema mehr. Auch lokale Zeitungen gehören zu den grossen
Verlegern und berichten hauptsächlich über den lokalen Sport, also
Fussball. Die Utopie von George Orwell war vielleicht 1948 noch
aktuell, abgesehen von der Sprechmaschine. Aber die Methoden waren
schon 1984 überholt. Heute ist die Kontrolle noch höher. Wenn ich
zum Beispiel eine Anzeige für ein Motorrad sehe, dann weiss ich,
dass ich die nächste Woche nur noch Anzeigen für Motorräder zu
sehen bekomme. Ja, es geht sogar so weit, dass ich Werbemails zum
erwähnten Thema erhalte.
The
big brother watching you!
In Kapitel 6 sind wir beim gemeinsamen Mittagessen dabei. Von einer heilen Welt ist hier nicht viel zu spüren. Der Speisesaal seines Ministeriums ist rappelvoll und die Tische und Stühle aus Stahl sehen ziemlich mitgenommen aus. Aus einem riesigen Fernseher dröhnen Statistiken und Loblieder des Grossen Bruders. Beim Essen wird angestanden und das Tablett, das die Küchenhilfe bringt, ist voller unbekannter, nach nichts schmeckenden Lebensmittel. Die Zukunft, so wie sie in George Orwells Roman dargestellt wird, ist alles andere als rosig. Wenn man bei seinen Vorgängern noch irgendwie etwas Schönes zu entdecken glaubt, herrscht bei Orwell ein Chaos, eine Misswirtschaft und ein Verschönern durch ständiges Einreden, bis man es selber glaubt. Während sie essen, suchen die Männer nach Rasierklingen. Keiner hat welche, und die, die noch welche haben, wollen sie nicht hergeben, weil sie denken, dass es zu wenige sind. Winston Smith denkt an das Ideal des muskulösen schlanken Manns und der vollbusigen Blondine, wie sich die Regierung seine auserwählten Untertanen vorstellt. Im Speisesaal sitzen aber nur kleine, dicke, gedunsene Menschen, die vor sich hin siefern.
Sein Tischnachbar arbeitet in der Abteilung für die neue Sprache. Er schreibt am 11. Wörterbuch mit und verspricht seinen Tischkollegen, dass sich die Sprache total ändern würde und die hier Anwesende müssten sie von Grund auf neu lernen. Es werden keine neuen Wörter und Begriffe ins Lexikon aufgenommen, sondern es werden sogar immer mehr gelöscht. Es werden ständig Wörter gestrichen und die Sprache gekürzt. Wenn es das Wort "gut" gibt, braucht man ja nicht auch noch ein Wort für "böse" oder "schlecht" und so weiter. Es reicht, wenn es gut oder ungut ist. Das Superlativ wird dann mit plusgut, pluplusgut oder eben plusungut gebildet. Die moderne Sprache ist ja echt easy! Es ist schon interessant, dass diese Sprachforscher im Roman nicht auch noch auf Smylies zurückgegriffen haben.
Orwell hat mit seinem Roman "1984" eine interessante Theorie aufgestellt. Er meint, dass die Sprache verloren geht, wenn die Menschen nicht mehr wissen, wofür sie sie eigentlich benutzen. Die Nuancen und die Schönheit der gesprochenen und geschriebenen Sprache sind leider nicht mehr so gefragt. Die Farben von damals sind schon ziemlich verblasst und werden immer mehr. Das Geschriebene wird immer mehr von Videos verdrängt, die die Infos auf 30 Sekunden zusammenfassen, weil die meisten Leute heutzutage nicht länger als das auf einem Video gucken. Eine Sprache mit über 100'000 verschiedenen Wörtern wird nur zu einem kleinen Teil genutzt. So soll Cervantes in seinem berühmten Roman rund 8'000 Worte nutzen, ein moderner Rapper kommt nicht einmal auf 30!
Wenn es noch Hoffnung gibt, liegt sie bei en Proles, beginnt Winston das siebte Kapitel zu schreiben.
Neben
dem Grossen Bruder und seinen Leuten der Partei gibt's noch eine
Schicht von Staatsangestellten, die in den verschiedenen Ministerien
arbeiten. Die meisten Menschen im Jahr 1984 sind aber Proleten. Ganze
85 % der Bevölkerung gehören zu dieser Gruppe. Sie arbeiten in den
Fabriken, in den niedrigen Diensten und sind Soldaten. In ihren Wohn-
und Arbeitsvierteln gibt's fast keine Polizei. Diebstahl,
Strassenraub, Prostitution, Rauschgift- und Strassenhandel mit
Rasierklingen sind an der Tagesordnung. Geschlechtsverkehr, auch
ausserhalb der Ehe, und Scheidungen sind erlaubt. Es ist wichtig,
dass wir genug Nachwuchs haben, der die Drecksarbeiten übernimmt.
Pole und Tiere sind frei!
Im letzten Kapitel des ersten Teils von George Orwells Zukunftsroman nimmt uns die Hauptfigur, Wilson Smith, in eines der Wohnviertel der einfachen Bevölkerung, der Proles, mit. Eigentlich findet der Grosse Bruder es gut, wenn sich die Parteimitglieder wie Smith nach der Arbeit im Gemeinschaftshaus treffen. Es gibt interessante Veranstaltungen, Vorträge, Diskussionsrunden und auch gemeinsame Sport- oder Spielaktivitäten. Wie schon gesagt, die Partei findet es gut, aber es gibt keine entsprechende Vorschrift. Smith ist sich aber sicher, dass im Gemeinschaftshaus Buch über die Besucher geführt wird. Deshalb sollte man nicht allzu oft und ohne Entschuldigung sich dort nicht einfinden. Die Gedankenpolizei könnte schon bald auf andere Gedanken kommen und mit dieser Institution anzulegen, ist nicht ratsam.
Heute nach der Arbeit hatte er einfach keine Lust und wollte lieber einen Spaziergang machen. Er ging weg von den Wohnvierteln, in denen Menschen wie er wohnen. Er hatte ein schlechtes Gewissen. Wenn er am Anfang auf eine Streife getroffen worden wäre, hätte er die Ausrede noch einfach rüberbringen können. Er wäre noch voller Gedanken aus der Arbeit falsch abgebogen und bedankt sich herzlich für das Treffen auf die Streife, welche ihm den richtigen Weg weisen würde. Aber weiter weg und weiter im Viertel der Proleten wäre es echt schwer, eine passende Ausrede zu finden.
Da geht ein alter Mann vor ihm über die Strasse. Alte Menschen sind selten und dieser Mann, der humpelt und einen Stock benutzt, muss schon über 80 Jahre alt sein. Er kennt die Welt also noch vor der Revolution! Solche Menschen trifft man nicht alle Tage. Die Proleten haben es nicht leicht und sterben oft schon vor der 60. Der alte Mann geht durch eine Schwenktür und verschwindet in einer der zahlreichen Bars, die den Proleten zur Verfügung stehen. Die Fenster sind voller Staub und Dreck, man kann nicht ins Lokal sehen. Smith geht ohne zu zögern in die Kneipe, in die der alte Mann verschwunden ist. Der Mann steht an der Bar, Smith stellt sich dazu und lädt den Mann zu einem Bier ein. Für die einfachen Leute gibt's nur Bier, hier wird kein Gin ausgeschenkt wie bei den Parteimitgliedern, welche wiederum offiziell kein Bier bekommen, dies aber leicht auf dem Schwarzmarkt bekommen. Smith setzt sich mit dem alten Mann an einen freien Tisch und versucht, ihn über seine Jugend auszufragen. Der alte Mann erinnert sich an die Beerdigung einer seiner Tanten und an Zylinderhüte. Er erinnert sich an Kleinigkeiten, die ihm im Gedächtnis geblieben sind. Aber er kann sich nicht an das Wesentliche erinnern. Smith gibt sein Bestes, aber leider ohne Erfolg. Diese einmalige Gelegenheit bleibt für ihn unbefriedigend. Also bleiben nur die Bücher der Partei und die Berichte. Er weiss leider genau, dass alle Informationen nicht nur einmal umgeschrieben wurden und in naher Zukunft vielleicht noch mehrmals abgeändert werden.
Er ist ziemlich enttäuscht und verlässt das Bierlokal. Er wandert in Gedanken verloren durch die Strassen, bis er vor dem Geschäft steht, wo er vor Monaten sein Tagebuch gekauft hat. Ist das ein Zufall oder hat ihn sein Unterbewusstsein erneut hierher geführt? Er geht schnell ins Geschäft, wo der Verkäufer eine Petroleumlampe anzündet. Er erinnert sich an Winston Smith und schwärmt von der guten Papierqualität der Agenda, die er bei ihm erstand. Die guten Zeiten für Antiquariate sind lange vorbei. Es finden sich keine alten Sachen mehr und für das wenige, was in seinem Laden noch zu finden ist, interessiert sich niemand. Der Besitzer führt Smith in den ersten Stock des Ladengeschäfts. Hier hat er mit seiner Frau gewohnt, solange sie noch am Leben war. Der Raum sah auch so aus, als ob noch jemand hier wohnen würde. Der Ohrsessel neben dem Kamin, der Esstisch, die Bilder an der Wand. Smith dachte kurz nach. Den Raum könnte man sicher für wenig Geld mieten. Im Sessel vor dem prasselnden Feuer von einer Zeit vor dem Grossen Bruder träumen.